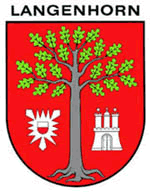Anekdoten
Ein sehr begüterter Hamburger Makler namens Emil Römling legte den Bärenhof um die Jahrhundertwende am Ochsenzoll Ecke Langenhorner Chaussee / Stockflethweg an, nachdem er zuvor den Semmelhackschen Bauernhof erworben und das alte weichgedeckte Haus abgerissen hatte.
Römling war ein weitgereister Mann. Im fernen China hatte er durch den Verkauf von Nähnadeln ein großes Vermögen angesammelt, hieß es. In seine Vaterstadt zurückgekehrt, galt er jedoch bald als Sonderling. Mehr und mehr verzauberten ihn verwunschene Schlösser, wehrhafte Burgen, verschnörkelte Türmchen und starkes Gemäuer. Der Volksmund dichtete, dies' sei ein Erbteil seiner Vorfahren, die im Württembergischen als kühne Raubritter gehaust haben sollen.
Da solche Bauten und Ruinen in unseren Breiten selten waren, schuf Römling sich am Ochsenzoll seine „eigene Burg“.
Zuerst ließ er Hauptgebäude und Hexenturm errichten. In den Turm zog ein altes Fräulein ein, das Römling mit "Turmhexe" anzusprechen pflegte und dafür, daß es dies duldete, mietfrei wohnte. Außer der leibhaftigen belebte auch noch eine ausgestopfte Hexe die Räume. Sie saß an seinem Tisch, wenn er aß und trank, und mit ihr mußte die Brotfrau, die alle paar Tage erschien und eine Schwäche für Kognak hatte, auf dem Hofplatz tanzen. Ochsenzolls Jugend hatte ihr Gaudium daran. Römling stellte eigens zu diesem Zweck in der sogenannten Kapelle ein Grammophon mit dem damals üblichen großen Trichter auf. Manches Mal holte er auch Burschen und Mägde heran und ließ sie für fünf Groschen mit seiner Stoffhexe tanzen. Darüber brach er alsbald in ein höllisches Gelächter aus.
Römling erwarb ständig zum Teil damals schon wertvolle Antiquitäten und Plastiken aus nah und fern und sammelte sie auf dem Bärenhof. So kaufte er beim Abbruch des alten Zollhauses St. Annen in Hamburg Fenster, Türen und ganze Holztäfelungen auf.
Der Maurer Korl Eenbeen - so genannt wegen eines künstlichen Beines- und der Arbeitsmann Jochen Kobei hatten von Römling den Auftrag erhalten, alle diese merkwürdigen Mauerbrocken, Plastiken, Wappen und Fenster mit Jahreszahlen aus längst vergangenen Zeiten in Bauten und Ruinen einzufügen.
Als älteste Jahreszahl soll damals 1547 eingemeißelt gewesen sein. Der Reliefschmuck einer Wappenzeichnung mit zwei Sternen über dem Tor zum Hexenturm trägt noch heute die Zahl „1580“, wäre somit also ältestes historisches Zeugnis am Platze.
Ursprünglich zierte auch ein Brunnenhäuschen das Gelände. Römling erstand es beim Freiherrn von Pohl aus dessen Wintergarten am Klosterstern. Die Pumpe darin lieferte später viele Jahre hindurch den Bewohnern des Bärenhofs kostbares Wasser. Längst ist sie verschollen.
Seinen eigenartigen Namen trug der Bärenhof zu Recht. Römling nämlich hielt dort eine Zeitlang Bären und sogar einen "Bärenjäger", Vadder Vels. Der konnte nun zwar notfalls zahme Bären füttern; wilde bekam er jedoch niemals zu Angesicht.
Eine unheimliche Geschichte ging damals von Mund zu Mund. Bauern aus der Nachbarschaft hatten sich nach langem Zögern zusammengetan, um mit dem zottigen Spuk am Ochsenzoll endlich aufzuräumen. Einer der frei umhertollenden Bären drehte jedoch den Spieß um; er biß einen der Wagemutigen. Die anderen suchten schleunigst das Weite. Römling dagegen fand Spaß an diesem ungleichen Bärenkampf. Vom Fenster aus hatte er alles beobachtet, und wenige Tage später ließ er am Haus diese Inschrift eingravieren:
„Wer sich will kratzen mit dem Bär'n, des Haut muß erst noch dicker wer'n“ !
Wohl war der Angriff auf seine Lieblingstiere siegreich abgeschlagen worden. Seiner Bären durfte Römling sich dennoch nicht mehr lange erfreuen. Die Ordnungsbehörde schritt ein, die Bären wurden in Hagenbecks Tierpark gebracht. Das Relief eines grimmig dreinschauenden Bären aber mit furchterregenden langen Krallen hat sich bis heute auf dem Hof erhalten.
Später verkaufte Römling seine Langenhorner Anwesen, so auch seinen Burghof. Er zog nach Süddeutschland. Die Inflation nach dem 1. Weltkrieg brachte ihn um den Rest seines einst so beachtlichen Vermögens. Völlig verarmt, wurde er nach seinem Tode in der neuen Heimat auf Gemeindekosten zu Grabe getragen.
Der Bärenhof entwickelte sich nach dem Umbau zu einer gern besuchten Gaststätte. Kurz vor Ausbruch des 2. Weltkrieges veräußerte der Gastwirt die Gebäude. Abermals wurde der Hof umgestaltet. Ein paar Einzelhändler ließen sich nun darin nieder. Hinter den Regalen ihrer kleinen Läden verbergen sich heute noch die letzten Zeugen einstiger Pracht.
„Fünf Sinne hat der Mensch, also muß auch ich fünf Türme bauen“, pflegte Römling zu sagen. (Die Spitzhacke verschonte zwei Türme, darunter den Hexenturm). Bewohner der Gegend aber hegten oft genug Zweifel, ob der Ausspruch von den fünf Sinnen auch auf ihn - diesen Sonderling - zuträfe.
Detlev Ehlers
Wer, von der Stadt kommend, der Langenhorner Chaussee nach Norden folgt, stößt eine Viertelstunde Fußwegs vor dem Ochsenzoll zur Linken auf eine Flur, die von alten Anwohnern „Venusberg" genannt wird. Sie liegt unweit der Stelle, an der der Neubergerweg in die Chaussee einmündet. Allerdings kann man heute dort keinen Berg, nicht einmal einen Hügel entdecken; nur eine leichte Bodenwelle deutet noch den Ort an, wo sich einst ein Hügelgrab erhob, eben jener Venusberg. Früher wurden nämlich auch Hügel als Berge bezeichnet. Dabei hieß dieser Hügel am Tükkobsmoor wohl ursprünglich der Veensbarg das ist Sumpf - oder Moorberg, und war - wie der Lustberg in Fuhlsbüttel- eine vorgeschichtliche Grabanlage längs des alten Heer- und Ochsenweges. In christlicher Zeit brachte die Kirche die Stätten heidnischen Ahnenkults in Verruf, und die Gläubigen mieden sie, weil sie sich vor Zauberei und bösem Geisterspuk fürchteten. So wurde auch aus dem Veensbarg ein Venusberg, ein Berg der Zauberin Venus, auf dem es nicht immer mit rechten Dingen zuging. Auf diesem Berge, so erzählt die Sage, wuchs vor Zeiten eine mächtige Buche, an derem Stamme stets eine dicke Kröte saß, die niemand anders als die verzauberte Frau Venus selbst war. Die Buche aber war eine richtige Traumbuche. Die Jungfrau nämlich, die in der ersten Frühlingsnacht unter ihren Zweigen von ihrem Liebsten träumt, wird unversehens Macht über ihn gewinnen und als Ehgemahl heimführen. Doch währt das Glück nur kurze Zeit, nur bis zum nächsten Neumond, dann müssen die Liebenden dafür mit dem Leben zahlen. Man schreibt das Jahr 1591. Pawel Knacke hat Anna Krohn, die Witwe vom Vogtshof geheiratet und wird nun selbst Vogt in Langenhorn. Seine Tochter Lena kommt mit ihm auf den Hof. Sie ist drall und kräftig und so breit wie ein Heuwagen; ja, sie ersetzt ihm einen Knecht, weil sie unverdrossen und unermüdlich bei der Feldarbeit zupackt und mit den jungen Männern wetteifert. Und doch wird sie von den Burschen gemieden, keiner fordert sie beim Erntefest zum Tanze auf, kein Freier hält um sie an, denn sie ist mall und dösig im Kopfe. Wie aber doch einmal der Nachbarsohn Gerd Framheim, der schmuckste Bursche im Dorfe, zum Scherze die Polka mit ihr tanzt, ist sie sofort in ihn verliebt, ohne jedoch von seiner Seite auf Erwiderung ihres Gefühls zu stoßen. Alle Versuche, seine Zuneigung zu erringen, schlagen fehl, und schon kommt sie ins Gerede, dem Burschen nachzulaufen. Da hofft sie, auf dem Venusberg Hilfe zu finden. In jeder ersten Frühlingsnacht schleicht sie hinaus, um unter der Buche den Zauber zu probieren. Aber alle Bemühungen sind vergeblich, immer träumt sie nur von Kühen und Schweinen und von der Arbeit auf den Feldern und leider nie von dem Liebsten. Endlich, nach vielen enttäuschenden Versuchen, stellt sich doch der ersehnte Traum ein, und sie träumt wirklich von ihrem Gerd. Überglücklich wacht sie am nächsten Morgen auf, legt die Kröte behutsam in ihren Korb und rennt den Heerweg hinab ins Dorf. Aufgeregt berichtet sie dort über den wunderbaren Traum auf dem Venusberg. Doch alle lachen sie nur aus und lassen es auch nicht an höhnischen Bemerkungen über ihren Geisteszustand fehlen. Wie sie aber die dicke Kröte in ihrem Korbe erblicken, die zur Bekräftigung der Erzählung dauernd mit dem Kopfe nickt, verstummt ihr Lachen, und Zweifel werden laut. Ungeheuer aber wird ihr Erstaunen, als just in diesem Augenblicke Gerd Framheim daherkommt, vor Lena niederkniet und sie küßt. Stumm ergreift er ihre Hand und führt sie hinweg auf seinem Hof. Dort wird alles zur Vermählung gerüstet und kurz darauf die Hochzeit gefeiert Es ist fürwahr eine große Hochzeit. Drei Tage und Nächte hält das Tanzen, Schmausen und Trinken schon an. Die dicke Kröte von der Traumbuche sitzt in ihrem Korb auf dem Tanzboden und nickt immer noch mit dem Kopfe. Keiner kümmert sich um sie, auch der Venusberg ist längs vergessen. In ihrem großen Glück will Lena nicht mehr an den Zauber glauben; was kümmert sie die Spökelei. Die vierte Nacht, die Neumondnacht, bricht an. Vom Westen her türmen sich dunkle Wolken über dem Schattbrook auf, und kurze, heftige Windstöße jagen über das Moor. Ein böses Unwetter zieht herauf. Die Tanzmusik verstummt, und die Hochzeitsgäste drängen nach Hause. Da zuckt der erste Blitz auf und schlägt gleich in das Hochzeitshaus ein. Im Nu steht das Dach in Flammen, und das Haus brennt lichterloh. Es brennt bis zu den Grundmauern nieder, nichts kann gerettet werden, auch Lena und Gerd kommen im lodernden Feuer um. Augenzeugen, die zum Löschen herbeieilen, berichten später, daß nur eine dunkle Gestalt aus der feurigen Glut in die Wolken emporgestiegen und dann entschwunden sei. Vom Ende der Traumbuche erzählt die Überlieferung nichts; den Venusberg aber haben Schatzsucher aufgegraben und nach Gold durchwühlt. Noch hundert Jahre später ist er als auffälliger Hügel vorhanden, und der Hamburger „Constabler und Kartograph“ Georg Ferdinand Hartmann zeichnet ihn 1750 als markanten Geländepunkt in seine Karte von Langenhorn ein. Im 19. Jahrhundert wird er beim Ausbau der Langenhorner Chaussee vollends abgetragen, und heute kündet nur noch ein Flurname von den Ereignissen, die dort einst ihren Anfang nahmen.
Im äußeren Südzipfel des dänischen Herzogtums Holstein- am Tarpenbek, stand vor gut hundert Jahren eine Lehmkate. Sie hockte neben Hügelgräbern, die heute nicht mehr da sind, war damals schon uralt. Niedrig, verfallen mit zerzaustem Strohdach stand sie noch bis zum vorigen Jahrhundert. Dann brannte sie in den achtziger Jahren ab. Und mit ihr verbrannten etliche vergilbte Schriftstücke in dänischer Sprache. Maria von Abercron, die dem Elternhaus entfloh oder daraus verstoßen worden war, fand nach trostlosen Irrfahrten in der Garstedter Heide in dieser leeren Hütte, elend, verhungert, zerschlagen und krank, Unterkunft. Von fremden Menschen wurde sie wieder gesund gepflegt. Sie hat den Spaten dann selbst in die schmalen Hände genommen und ein Stückchen Heide urbar gemacht. Da die Leute von ihr nichts wußten, wurde sie bald Tarpen- Trina genannt. Doch später wurde sie von neuen Schicksalsschlägen getroffen, sie begann nun äußerlich und moralisch zu verkommen und war bald als Bettlerin und Landstreicherin bekannt. Tarpen- Trina starb am 19. Nov. 1887 und wurde in Niendorf begraben. Nach ihrem Tode wurde erst bekannt, daß sie eine Nichte des dänischen Königs gewesen sein soll. An Stelle der alten Kate, wo Tarpen- Trina Zuflucht fand, stand die Wirtschaft „Zur Tarpenkate". Heute ist hier eine türkische Begegnungsstätte.
Schule - - - - - - - - - - - - - - - Gefängnis ohne Gitter
Schulweg - - - - - - - - - - - - - Zur Hölle und zurück
Direktor - - - - - - - - - - - - - - Herrscher ohne Krone
Lehrerkollegium - - - - - - - - Die oberen Zehntausend
Lehrer - - - - - - - - - - - - - - - Der Mann der zuviel wußte
Lehrerin - - - - - - - - - - - - - - Teufel in Seide
Ferien - - - - - - - - - - - - - - - Endstation Sehnsucht
Klassenarbeit - - - - - - - - - - Verdammt in alle Ewigkeit
In der Stunde - - - - - - - - - - Die Helden sind müde
In der Pause - - - - - - - - - - - Außer Rand und Band
Abschreiben - - - - - - - - - - - Schmutziger Lorbeer
Vor der Klassenarbeit - - - - - Die Faust im Nacken
Nach dem Zeugnis - - - - - - - Auch Helden können weinen
Schulentlassung - - - - - - - - - Einer kam durch
Das erste Gebot: IHR SOLLT NICHT IMMER VON KRANKHEITEN REDEN!
Irgendwas plagt doch heut‘ einen jeden.
Ein bisschen Rheuma, schlechtes Gehör,
verschlissene Knochen, das Gehen fällt schwer.
Der Kreislauf wird träger und schlechter das Sehen,
so wie einst kann man nicht mehr zum Tanzen gehen,
Ja, man ist alt, das Gedächtnis kriegt Sprünge,
es kommen noch mehr unangenehme Dinge.
Trotzdem ist das Leben immer noch schön,
man muss nur die kleinen Dinge seh‘n:
Wie die Schneeglöckchen so tapfer steh‘n,
Kinder sich beim Spiele dreh‘n,
Osterglocken heraus sich schieben,
die Sträucher sich schmücken mit neuen Trieben.
Und über allem lacht die Sonne.
Freunde, das Leben ist doch eine Wonne
Das zweite Gebot: IHR SOLLT MIT EURER RENTE NICHT SPAREN!
Ihr habt sie erschuftet in vielen Jahren.
Jetzt gönnt Euch noch etwas Schönes vom Leben,
nicht alles sollt ihr den Enkeln geben.
Ihr habt nach dem Krieg mit Null angefangen,
so ist es den Jungen noch nie ergangen.
Und immer in‘s gemachte Bett sich zu legen,
ist nicht unbedingt ein Segen.
Haut mal auf die Pauke, macht es Euch schön,
wer weiß, wie die nächsten Tage ausseh‘n.
Doch noch lacht über allem die Sonne.
Freunde, das Leben ist doch eine Wonne!
Das dritte Gebot: lHR SOLLT EUCH NOCH IN DER WELT UMSEHEN.
Nicht immer in den hiesigen Stadtgarten geh‘n.
Fahrt in‘s Gebirge oder auch an die See,
gönnt Euch die Sonne, das Wasser, den Schnee.
Es treibt Euch niemand, jetzt habt Ihr Zeit,
die Welt ist so schön und herrlich weit.
Auch in‘s Ausland fahren, ist kein Problem,
mit Bus oder Bahn reist es sich bequem.
Man besichtigt dabei manche tolle Stadt
und genießt, was das Hotel zu bieten hat.
Dann erfreut jeden wieder die heimische Sonne.
Freunde, das Leben ist doch eine Wonne!
Das vierte Gebot: IHR SOLLT AUCH NIEMALS RESIGNIEREN.
Lasst vom Gerede der Leute Euch nicht irritieren.
Seid Ihr noch zusammen, ein älteres Paar,
seid dankbar dafür, es ist wunderbar.
Einsamkeit kann oft schrecklich sein,
sucht die Gesellschaft, bleibt nicht allein.
Zusammen leben, zusammen reisen,
zusammen ausgeh‘n, zusammen toll speisen.
Gebt Wärme, genießt Gemütlichkeit,
vor allem auch die Zärtlichkeit.
Es gibt nichts Schöneres unter der Sonne.
Freunde, das Leben ist doch eine Wonne!
Das fünfte Gebot: EURE HÄNDE SOLLT NICHT IN DEN SCHOSS IHR LEGEN.
Ihr sollt, so Ihr könnt, Geist und Glieder bewegen.
Geht Schwimmen und Wandern, macht Gymnastik und Tanz,
dann bleibt Ihr fit und es gibt Euch Glanz.
Und so trainiert Ihr den Verstand:
interessiert Euch für alles Neue im Land.
Die Welt dreht sich schneller als je zuvor,
bei Diskussionen spitzt das Ohr,
sprecht mit den Jungen, so lernt Ihr dazu,
denn der Geist braucht Bewegung und nicht die Ruh.
So steht Ihr noch lange und frisch in der Sonne.
Freunde, das Leben ist doch eine Wonne!
Dor heff ik mol so spekuleert,
wat in de Johr is all passeert.
Wenn ik mi dat so överlech,
harrn wi dat fröher uk nich schlecht.
Denn wat se hüt erst leern in`n Kursus,
dat weer för uns dachdächlich Usus.
Wie ist dat denn mit „Kreativität“,
oder wie dat dore Fremdwort heet?
Keener wuss wat dat is,
aber dat is doch wull ganz gewiß:
Wie kunnen Sirup, Seep un Puddings kaken,
Börsten, Käs un Bodder maken,
kunnen ut Sacktau Faden spinnen,
Kleeder weben ut Wull un Linnen.
Ut selbstbute Tabak Zigaretten dreihn,
ut oole Säcke Feudel neihn,
kunnen Schnaps brennen mit Whisky-Geschmack,
un prima Schwattbrot hemm wi backt.
Ach, wat weern wi kreativ!
Bloß, wie wussen dat nich.
Mit Kommunikation harn wi uk keen Problem,
denn wer morgens na de Kopmann henkeem,
de kommonikeere lang un breet,
un wusse dann över allns Bescheed.
Mit „Trimm-Dich“ harn wi överhaupt keen Sorgen,
to Foot ging dat jeden Morgen
up de Arbeit vör een langen Dag.
Un sull man des Abends mal ut,
so kreeg man sick sien Fahrrad rut,
un mit sein eegen Muskelkraft,
hett man uk wiede Wege schafft.
So kunn man ruhig düchtig eeten
un de Kalorien vergeten.
Man sä uk nich „De is doch veel to dick“,
dat heet höchstens „Na, wat is se gut bi Schick“.
Wie hemm trimmt so manche Stunn,
bloß wie wußten dor nix vun.
Und mit de ganze Umweltschiet
dor harn wie uk keen Ärger mit.
Dat Seepenwater hem wie to`n Feudeln wort,
leere Buddeln hett man för Saft opsport,
ut oole Reifen wurrn Footmatten makt,
un mit Buschholt Middag kaakt.
Mit Torf hem wie de Stuben heizt,
un denn de Asch op Glatties streut.
Sold weer to düer, un op disse Art
wor so manche Groschen spart.
Alles wor bet to Enn opschleeten
un denn eerst in de Schietkuhl schmeeten.
So hemm wie uk de Umwelt schützt,
bloß dat hett man nich veel nützt.
Mit „Entspannung“ harn wie uk keen Last,
denn dat geef nich so`n Iel un Hast.
Dat geef keen Fernsehn mit Dodschlag un Mord,
keen Dalli-Dalli un keen Report.
Keemst du abends in de Stuuv,
neemst du dat Flickkram ut de Schuuv.
De Mann keek noch mal in dat Blatt,
un leeg in Ogenblick denn platt.
So levten wie ruhig im Stillen
un brukten keen Beruhigungspillen
un keen „Entspannungstraining“, sun Tüdelkram,
wie kunnen uk ohne in Rage kaamen.
Wi harn uk noch keen „Emanzipation“.
Wer kenn dat dore Fremdwort schon.
Aber wie weern liekers emanzipiert,
bloß man hett dat nich so spöört.
De Männer hemm dat öberhaupt nich markt,
denn wat harn se suns wull quarkt.
Ja, dat weer en annere Tiet,
un de liggt torüch nu so wiet.
Manchmal bin ik nich wiss,
ob dat nu allns beeter is.
Überlieferungen und Anekdoten aus dem Buch "Aus Langenhorns Vergangenheit" von K. A. Schlüter 1932
Überlieferungen gehen kaum über die vierte Generation rückwärts, nur bei ganz großen Ereignissen gräbt sich die Erinnerung tiefer ein. So war es mit den Kriegsereignissen der Vergangenheit in Langenhorn. Erinnerungen an den 30jährigen Krieg sind längst abgeklungen. Den Behauptungen alter Leute, daß alle Häuser Langenhorns im 30jährigen Kriege vernichtet worden seien, möchte ich kaum eine Wahrscheinlichkeit beimessen.
Das Hospital hat alles sehr sorgfältig, besonders die Einnahmen und Ausgaben, gebucht. Da in jener Zeit den Eingesessenen das nötige Bauholz geschenkt wurde, so ist jedesmal ein Vermerk darüber eingetragen. Während des ganzen 30jährigen Krieges aber findet sich keine Notiz, wie eine solche zum Beispiel 1674 eingetragen steht: „nach Langenhorn gefahren, um dem Manne, dem das Haus abgebrannt ist, Bäume anzuweisen.“ Ich möchte daraus schließen, daß ein Teil der alten Bauernhäuser, Hufen II, III, VI, VII, die Katen VII und IX, die bis 1900 und zum Teil bis 1930 standen, bis mindestens auf 1600 und vorher zurückgehen.
Zahlreicher sind die Erinnerungen an die Franzosenzeit, in der die Langenhorner Bevölkerung alle Not und Schrecknis einer rücksichtslosen Besetzung und Ausnutzung durch einen übermütigen Feind auskosten mußte. Die erste Besetzung setzte die Bevölkerung so in Angst und Schrecken, daß viele mit ihrer Habe ins Schattbrook oder in das Hoheliedthsgrundmoor oder gar auf dänisches Gebiet flüchteten. Vorzugsweise war es zunächst die französische Kavallerie, die die entlegenen Ortschaften des Hamburger Gebietes durchstreifte. In diesen Tagen der ersten Besetzung muß es sehr gewalttätig zugegangen sein. Das Hospital berichtet über nächtliche Unsicherheit, Diebstähle, Raub und Gewalttat auf offener Straße und in den Häusern.
Ein alter Mann erzählte meinem Großvater später, er sei im Dorf geblieben, um sein Eigentum zu schützen. Da sei ein Franzose mit blankem Säbel auf ihn eingedrungen, hätte ihn mit Erstechen bedroht und hätte ganz fürchterlich „sakersudert“. Er hätte in seiner „Fahrt“ nichts anderes sagen können als: „Oui Möppel! oui Möppel!“, worauf der Franzose schließlich von ihm abgelassen hätte. „Junge, harr ick dat beten franzeusch nich kunnt, denn harr de Oos mi dotsteken“, pflegte er seinen Bericht zu schließen.
Da den jungen Bauernmädchen von der wilden Soldateska am meisten nachgestellt wurde, waren die Mädchen in der ersten wilden Zeit in Sicherheit gebracht. Trotzdem geschah es, daß ein Mädchen sich unvorsichtigerweise aus seinem Versteck hervorgewagt hatte. Zum Unglück lief sie einem französischen Reiter in die Quere, der sie sofort anfiel und in das Olmoor schleppen wollte. Auf ihre Hilferufe eilte Peter Dreyer herbei, ein junger starker Bauer. Der sah die Not des Mädchens und warf sich mit seinem Handbeil auf den Franzosen. Der versuchte, ihn zu erschießen, aber Peter Dreyers Beil war schneller. Er erschlug den Franzosen. Das Franzosengrab wurde mir von alten Leuten am Knick auf einer Koppel östlich der Tangstedter Landstraße kurz vor dem Olmoor gezeigt. (1932 ging der Fußweg kurz vor Enders über die Blutstätte.)
Die alte Frau Griem, deren Eltern beide die Franzosenzeit noch mit erlebt hatten, berichtete, daß auf dem Hofe ihrer Eltern Franzosen die gewöhnliche Bauernkost hohnlachend der Frau vor die Füße warfen. Braten, Weißbrot und Wein mußten unter allen Umständen beschafft werden, wenn man bösartige Schikanen vermeiden wollte. wohl war den französischen Soldaten bei längerer Besetzung, und besonders, als Langenhorn mit Hamburg zusammen französische Provinz geworden war, schlechte Behandlung der Bevölkerung verboten, Essen und Trinken genau vorgeschrieben. Leider hielten sie sich nicht daran. Langenhorn war weit entfernt von Hamburg, und zudem wechselte die Besatzung sehr häufig.
Durch Kriegskontributionen, Kriegsfuhren, Lieferungen von Lebensmitteln und Vieh aller Art, sowie von Fourage bis zum letzten ausgepreßt, wollte die Bevölkerung verzweifeln. Hinzu kamen die Aushebungen zur französischen Armee. Kein Wunder, daß eine Reihe von Bauernsöhnen bei Nacht und Nebel das Vaterhaus verließ, heimlich über die Grenze nach Niendorf, Garstedt, Tangstedt oder Hummelsbüttel ins Dänische entwich. Sie kannten das Gelände besser als die Fremden. Zwar war auch in Holstein durchaus noch keine Sicherheit für sie. Die Dänen, mit den Franzosen befreundet, lieferten die Ausreißer aus. So soll schließlich ein Langenhorner Bauernsohn sich weiter durchgeschlagen haben und zuletzt nach England gekommen sein.
Der Vogt Hans Peter Krohn, ein sehr wohlhabender Hufner, hatte kurz vor der Besetzung Langenhorns durch die Franzosen seine Gold- und Silbersachen in drei Kisten bei Nacht und Nebel in seinen Fischteichen, beim heutigen Bahnhof Süd, versenkt. Mit seiner Frau hatte er allein, ungesehen, wie er glaubte, das schwere Werk vollbracht. Nach dem Abzuge der Franzosen wollte er seinen Schatz heben. Er fand aber nur eine Kiste wieder; die anderen blieben verschwunden.
Mein Urgroßvater war damals 15 Jahre alt und als Junge auf dem Vogtshofe. Der hatte in der Nacht, da der Vogt seine Kisten versenkte, Zahnschmerzen gehabt. Er konnte nicht schlafen und hatte den Vogt und seine Frau bei ihrer Arbeit beobachtet. Als er dem Vogt das beim Ausgraben erzählte, meinte der: „Deubel ok, denn hebbt dat ok noch anner Lüd sehn; wer weet, ob de Franzosen mi de Kisten stahlen hebbt.“
Nach den Franzosen 1813 rückten unsere Verbündeten, die Russen als Befreier ein. Leider betrugen sie sich wenig freundlich. Gewiß, sie litten unter der fruchtbar strengen Kälte des damaligen Winters sehr. Alle Häuser und Katen wurden von ihnen auf das stärkste mit Einquartierung belegt. Die Witwe des 1813 verstorbenen Chirurgen Bayer erhielt für ihre kleine Kate mehr als ein Dutzend Russen einquartiert.
Sofort belegten die Russen die einzige heizbare Stube und setzten die arme Frau mit ihren sechs Kindern rücksichtslos hinaus auf die kalte Diele. Das jüngste Kind war noch kein halbes Jahr alt. Um sich und die Kinder warm zu halten, wanderte die Frau die ganze Nacht mit den Kindern auf und nieder. Aber gegen Morgen war sei gänzlich erschöpft und eines der Kleinsten völlig blaugefroren und bewegungslos geworden, so daß es dem Tode nahe war. Jetzt erst erbarmte sich ein mitleidiger Russe und verschaffte der armen Mutter und ihren Kindern in der warmen Stube ein Plätzchen.
Der Witwe Fromhein brachen die Russen kurzerhand die große Scheune ab und benutzten das Holzwerk dazu, um ihre Wachtfeuer zu unterhalten. Was die Franzosen den Bauern an Vieh noch gelassen hatten, das requirierten die Russen. Auf der Schlachterkoppel, hart nördlich der Süderschule, trieben sie viel Schlachtvieh zusammen, das zum großen Teil natürlich auch in den dänischen Dörfern der Umgebung beschlagnahmt worden war. Auf der Schlachterkoppel sollen Hunderte von Tieren geschlachtet worden sein. Tatsächlich sind am Ostrande der Koppel größere Mengen Rinderknochen ausgegraben worden.
Durch betrügerische russische Offiziere erlitten die Langenhorner Bauern einen finanziellen Verlust von über 1600 Mark. Eine ganz erhebliche Summe, wenn man bedenkt, daß es das letzte war, was die Bauern aufzubringen überhaupt noch imstande waren. An kleineren Gaunereien fehlte es auch nicht. Dem Landmann Treu am Grenzwege war ein herrenloses Pferd zugelaufen. Er ließ es am nächsten Sonntag in Eppendorf von der Kanzel bekanntmachen (abkanzeln). Bald darauf erschien ein russischer Soldat, gab vor, das Pferd gehöre seiner Truppe, und er solle es gegen Quittung abholen. Der Schwiegersohn von Treu, der in der Stadt wohnte, wollte nunmehr bei der russische Liquidationsbehörde das Futtergeld für den Gaul abheben; da aber erwies sich die Quittung als gefälscht.
Die Spuren des Gauners ließen sich bis Moisburg im Hannöverschen verfolgen. Dort hatte er das Pferd bei einem Landmann verkauft. Treu holte das Pferd zurück. Es kam zu einem Prozeß. Treu wurde gezwungen, das Pferd an den Moisburger zurückzugeben, da er kein Anrecht auf das Pferd hätte; die Futterkosten seien durch die Arbeitsleistung des Pferdes bezahlt; der Moisburger aber habe es mit Bargeld gekauft, wenn auch von einem Gauner.
Die Armut der Langenhorner Bevölkerung nach dem Kriege war unbeschreiblich. Die mündliche Überlieferung behauptet, daß 1815 in Langenhorn nur noch eine einzige Kuh vorhanden war. Es fehlte an Geld und Lebensmitteln. Viele Leute standen unmittelbar vor dem Verhungern. Wer Verwandte und gute Freunde im Holsteinischen hatte, konnte vielleicht noch etwas zur Lebensnotdurft erbitten; aber rosig sah es auch in den holsteinischen Dörfern nicht aus.
Auf dem Vogtshofe war es 1815 so schlimm, daß Besitzer und Gesinde buchstäblich hungerten. Als Gottfried August Kraemer den Hof pachten wollte - er war bis dahin Verwalter der Kupfermühle in Farmsen gewesen -, erhielt er schon bei einem recht niedrigen Pachtangebot den Zuschlag. Als er aber das Geld bar auf den Tisch legen sollte, hatte er nichts zur Hand. Die mißtrauischen Bauern glaubten, es mit einem dänischen Spion zu tun zu haben. Sie sperrten ihn in ein Hinterzimmer und setzten zwei Bauern als Wache davor. Auf seine Bitte erlaubte man ihm jedoch, einen Brief an seinen Bruder zu schreiben, er in Hamburg Professor am Johanneum war. Er bewegte sodann einen jungen Bauern dazu, auf seinem Reitpferde zur Stadt zu seinem Bruder zu reiten und ihm den Brief zu überbringen. Sein Bruder kam nach ein paar Stunden mit dem nötigen Gelde und konnte ihn aus seiner bedrängten Lage erlösen. Gleichzeitig brachte er einen Notar mit, der den Pachtvertrag in die gehörige Ordnung brachte.
Sobald das Gesinde erfuhr, daß es einen neuen Herrn bekommen hätte, trat es an ihn heran, führte ihn in die leere Speisekammer, zeigte ihm als einzige Nahrung ein Roggengrobbrot, das von Ratten fast gänzlich ausgehöhlt war. Sie baten ihn um Gottes Willen, ihnen doch etwas zu essen zu beschaffen. Von dem Gelde seines Bruders kaufte er sodann in der Fuhlsbütteler Wassermühle ein. Er schickte den Großknecht mit etwas Mehl und Grütze zum Hofe, damit sie zunächst erst einmal wieder Brot backen und sich satt essen konnten.
Auf dem Hofe lebte damals als Erbin die Tochter des vormaligen, sehr wohlhabenden Vogtes, Cornelius Conrad Krohn, mit Namen Anna- Maria. Sie soll sehr schön und auch wirtschaftlich sehr tüchtig gewesen sein. Auch nach Kraemers Pachtung führte sie ihm den Haushalt weiter. Kraemer hätte sie gern geheiratet und zu seiner Hausfrau gemacht. Auch Anna-Maria fand den stattlichen, hochgewachsenen, intelligenten und tüchtigen Gottfried August durchaus sympathisch, aber seine Werbung lehnte sie strikte ab. Sie wollte einmal einen „richtigen“ Bauern heiraten, der mit Stolz seine alte Tracht trüge: den langen, blauen Rock mit den großen Talerknöpfen, die kurzen Kniehosen mit den langen weißen Strümpfen und die schwarzen Schnallenschuhe. Aber ein Herrenbauer in der Art Kraemers, der ständig in seiner Herrentracht auf dem Reitpferde saß, war nicht ihr Fall. Alle Bemühungen Kraemers waren vergebens.
Nun geschah es, daß beide zu einer großen Bauernhochzeit zu den Krohns in Fuhlsbüttel eingeladen waren. Heimlich hatte sich Gottfried August die landesübliche Bauerntracht von eine guten Schneider bauen lassen. In vollem Bauernstaat erschien er auf der Hochzeit. Nun konnte Anna-Maria ihrem schon lange rebellischen Herzen nicht mehr widerstehen. Sie gab ihm ihr Ja-Wort, und die Hochzeit wurde bald darauf gefeiert. Leider ist Anna-Maria Kraemer, geb. Krohn sehr früh gestorben.
Die Erhebung Schleswig-Holsteins 1848/51 gegen die Dänen fand auch in Langenhorn lebhaften Widerhall. Mehrere junge Burschen eilten ihrem bedrängten Heimatlande zu Hilfe. Mein Großvater, der gerade an dem Bau des Hauses Langenhorner Chaussee 212 arbeitete, verließ den Bau, um drei Tage gegen die Dänen kämpfen zu helfen. Er erzählte, daß der Krieg verhältnismäßig gemütlich geführt wurde. Wurde es gegen Herbst zu naß und zu kalt, so brach man die Kriegshandlungen ab, bezog Winterquartier oder ging nach Hause. Im nächsten Frühjahr ging‘s dann wieder los. Auch die Waffen waren nicht so mörderisch. Die alten Vorderlader ohne gezogenen Lauf machten zwar einen Heidenlärm, waren aber auf 50 Meter Entfernung nicht mehr sonderlich gefährlich.
Auf die preußische Führung in der Schlacht bei Idstedt war er, wie alle Schleswig-Holsteiner, schlecht zu sprechen. Er behauptete immer, man habe die Munition für die leichte und schwere Artillerie absichtlich verwechseln lassen, so daß sie nicht schießen konnte und das schleswig-holsteinische Fußvolk nicht unterstützte. Nach anfänglichen Erfolgen gegen die Dänen hätten sie sich schließlich zurückziehen müssen. Außer ihm nahmen noch Hinrich Ehlers, Vollhufner, Butterhändler Timm und unser späterer Nachtwächter Christian Becker an der Erhebung Schleswig-Holsteins teil. Den letzteren uzte man häufig mit seinen Kriegstaten: "Swieg du man still, Krischan, du hest jä man blots de Ossen dräben“, oder: „du hest ja ünner de Brüch seten, wenn de Dänen schöten“. Dann wurde er fuchsteufelswild und war kaum durch einen steifen Grog zu versöhnen. Und das wollte was heißen.
Im Dänenkrieg 1864 kamen auch österreichische Truppen nach Holstein. Sie rückten zum Teil durch Hamburg und wunderten sich nicht wenig über die große, reiche Stadt. Ein Österreicher, der bei meinem Großvater in Quartier lag, äußerte sich: „Däs ham mer ja gar nit g‘wußt, daß unser Kaiser da heroben so a groß schöns Städtle hätt.“ Unsere Langenhorner vertrugen sich ausgezeichnet mit ihnen. Aber die derbe norddeutsche Bauernkost sagte den Österreichern wenig zu. Besonders die grauen Buchweizenklöße und das Schwarzsauer erregten ihr lebhaftes Mißtrauen: „Schuhwichs, Schuhwichs, essen wir net“, sagten sie und waren nicht zu bewegen, auch nur etwas davon zu kosten.
Etwa ein Dutzend junger Langenhorner Burschen nahm am Kriege 1870/71 teil. Die meisten kämpften im Regiment 76. Unter ihnen befand sich ein Zimmergeselle Hans Joachim Sahling. Ein Kriegskamerad von ihm erzählte: Sie lagen bei Loigny an einem Wall. Die französische Infanterie schoß immer heftiger und sicherer. Die Geschosse warfen kleine Sandwolken auf, die die hinter dem Wall liegenden 76er bestäubten. An einer besonders lebhaft beschossenen Ecke lag Sahling. Schließlich stand er auf und sagte trocken: „I gitt, i gitt, hier go ik weg, hier smiet’s mit Schiet.“ Ein Kamerad von ihm, der unmittelbar darauf an seinen Platz ging, wurde sofort durch einen Kopfschuß getötet. - Drei Kriegsteilnehmer kehrten nicht zurück. - Unter den Kriegsteilnehmern befand sich auch der „lange“ Hinrich Schwen, der später viele Jahre am Bornwege hinter der Irrenanstalt wohnte. Einige Jahre nach dem Kriege zeigte sich bei ihm der Beginn eines Zungenkrebses, dessen Wucherungen an der Zungenwurzel saßen. Dr. Martini im Eppendorfer Krankenhaus wollte ihn operieren. Hinrich Schwen sollte zu dem Zwecke chloroformiert werden. Aber davon wollte er nichts wissen. „Operieren, gewiß! Wenn dat sien mutt, denn man to! Aber chloroformieren lot ik mi nich.“ So wurde ihm dann ohne Narkose der Hals geöffnet und die Krebswucherung an der Zungenwurzel entfernt, ohne daß Hinrich Schwen sich viel gemuckst hätte. Als später einmal in Hamburg ein Ärztekongreß stattfand, ließ Dr. Martini ihn einladen und stellte diesen Hauptkerl dem Kongreß als ein Phänomen vor. Er war ein hünenhafter Mann von etwa 1,90 Meter Größe und dabei von gehöriger Breite, so daß man ihm ohne weiteres eine riesige Körperkraft zutrauen konnte. Mein Vater erzählte mir, daß Hinrich Schwen in seiner Vollkraft einen eichenen Kran von über drei Zentner Gewicht alleine ohne Hilfe auf den Wagen legen konnte. - Solcher Kraftgestalten und Kraftnaturen gab es früher mehrere. So erzählt man heute noch von Dietrich Hinsch, dem Urahnen des jetzigen Butterhändlers H. Hinsch, er sei so stark gewesen, daß er in jeder Hand einen Zentnersack Roggen waagerecht in der Schwebe halten konnte. Einem prahlerischen starken Müllergesellen der Mühle zu Fuhlsbüttel, der überall Zank und Streit machte, gewöhnte er die Zanksucht ganz plötzlich und gründlich ab, als er ihn ein wenig mit seinen gewaltigen Armen „liebevoll“ an seine Brust nahm. Als junger Mensch sollte er wegen Schmuggelei von drei französischen Gendarmen verhaftet und abgeführt werden. Aber er entwaffnete sie alle drei und warf sie kopfüber die Treppe hinunter. Daraufhin mußte er allerdings flüchten.
Auf dem Hoheliethsberg wohnte in den 50ger Jahren ein gewisser Hinrich Timm; ihn nannte man in Langenhorn ganz allgemein „Hinnerich Peerkraft.“ Der hatte gleichfalls so enorme Körperkräfte, daß er beispielsweise ein Pferd mit seinen Schultern vollständig vom Erdboden emporhob.
Als charakteristisches Zeitbild sei noch folgendes erzählt: In der Gastwirtschaft von Heinrich Dieckmann am Ochsenzoll erschien eines Tages ein Viehhändler, der in Hamburg Schweine zu Markt gebracht und gut verkauft hatte. Er war in ganz Stormarn bekannt als Flegel und Grobian erster Ordnung, allgemein gefürchtet als Schläger und durch seine große Körperkraft sehr gefährlich. Mit seinen beiden Begleitern brach er sofort Streit vom Zaune, machte mit dem Wirt einen Heidenskandal und trieb schließlich den langen Hein Dieckmann, der gewiß nicht zimperlich war, aus seinem eigenen Hause hinaus, und demolierte das ganze Lokal. In seiner „Fahrt“ eilte Dieckmann zu Nachbarn, um gegen den wilden Viehhändler Hilfe herbeizuholen. Bei Büch (heute Kohl) traf er Jochen Remstedt und Hein Krohn aus Langenhorn, die sofort zur Hilfe mitgingen. Im Lokale von Dieckmann sah es wüst aus. Der Viehhändler hatte sämtliche Gläser, Tassen und dergleichen zertrümmert. Als er Hein Dieckmann mit seinen Helfern kommen sah, sprang er ihnen bis zur Tür entgegen, um ihnen den Eingang zu verwehren. Er drohte jeden niederzuschlagen. „O, lat mi doch ok mal’n beten rin, ik müch ok mal na de Weertschaft,“ sagte Jochen gemütlich. Der Viehhändler griff ihn grimmig an, Jochen aber bewahrte seine unerschütterliche Ruhe. Plötzlich packte er den „wilden Mann“ mit Riesenkraft; ehe er sich’s der Rüpel versah, lag er am Boden und nun bezog er mit seiner eigenen Peitsche eine solche Tracht Prügel, daß er ganz klein wurde und jämmerlich um Gnade bat; auch seine Begleiter hatten eine nette Abreibung erhalten. Dieckmann mußte nun den Schaden aufrechnen, die Rechnung war nicht klein, und der Viehhändler mußte tief in die Tasche langen. Dann setzte man die Radaubrüder auf ihren Wagen, gehen konnten sie nicht mehr recht, und ließ sie abfahren. Später soll der Viehhändler einen großen Bogen gemacht haben.
Es muß angemerkt werden, daß für ganz Langenhorn früher nur ein einziger Polizei-Offiziant vorhanden und daher polizeiliche Hilfe nicht immer zu erreichen. Es hieß also: Hilf dir selbst. Das bekam ein Einbrecher zu verspüren, der acht Tage lang bald hier, bald da in Langenhorn einbrach und von der Polizei nicht zu fassen war. Schließlich ereilte ihn doch sein Schicksal. Er brach im „Wattkorn“ ein. August Schwen hörte nachts ein Geräusch, wurde munter und sah, wie ein Einbrecher gerade seinen Zylinder (Sekretär) erbrochen hatte und die Wertsachen einpackte. Na, mit dem sprach er etwas ortsüblich plattdeutsch, und das verstand der Gauner sofort. Nach ein paar Stunden kam zufällig der Polizei-Offiziant zum Wattkorn, ließ sich einen einschenken und sprach, wovon eben jedermann in Langenhorn erzählte, über die nächtlichen Einbrüche. „Jä“, seggt August, „hüt Nach is he bi mi west; de Swinegel hett mi minen schönen Zylinder tweibraken. Na, den heff ik dat awerst afflehrt!“
„Mein Gott“, sagt der Beamte ärgerlich, „hätten Sie doch den Kerl festgehalten, dann wären wir jetzt von dieser Plage befreit.“ „Hem Se man keen Angst, de kümmt nich wedder. Vör‘n Stünn‘s Tied leeg he hier noch achtern Tun un kunn noch ne recht krupen. De hett genog.“ Und wenn man die großen Flossen von August Schwen sich ansah, dann glaubte man ihm das ohne weiteres. Tatsächlich hörten die Einbrüche danach wie mit einem Schlage auf.
Höflichkeit und geschliffene Umgangsformen suchte man im 19. Jahrhundert vergebens in Langenhorn. Die Bauern waren wohl aufrichtig und zuverlässig, aber auch ungemein kantig, knorrig und grob. Als der erste Kraemer, ein Pastorensohn aus Bleckede bei Magdeburg, sich in Langenhorn verheiratet hatte, hätte seine alte Mutter ihren Jüngsten gern einmal wiedergesehen. Aber Kraemer, der mit Aufbietung aller Kräfte den in der Franzosenzeit heruntergewirtschafteten Hof zu heben bemüht war und außerdem noch die Vogtsgeschäfte führte, konnte für längere Zeit nicht abkommen. So kam denn die alte Frau nach Hamburg, wohnte ein Halbes Jahr bei ihrem Sohne und lernte hier die Bauern in ihrer ganzen Grobschlächtigkeit kennen.
Beim Abschiede weinte und klagte sie, daß ihr Sohn unter solchen „Biestern und Viechern“ von Mensch sich abplagen müsse. Diesem Urteil muß man zugute halten, daß die alte Frau in Mitteldeutschland einen ganz anderen Menschenschlag vor sich hatte. Man darf auch nicht vergessen, daß die damalige furchtbar harte Zeit auch harte Menschen erzog. Immerhin aber blieb diese rauhe Aufrichtigkeit lange erhalten.
Auch gegenüber der Obrigkeit war man nicht sonderlich zimperlich. Kam der Bauervogt Jochen Kohrs zum Landherrn, so legte er sich mit beiden Ellbogen breit vor ihm auf den Tisch, um ihm in aller Gemütlichkeit sein Anliegen auseinanderzusetzen. Viele Jahrzehnte später noch hieß es, sobald ein junge sich mit beiden Ellbogen über den Tisch legte: „Jung, wullt du mal mit den Ellbagen vun den Disch; du liggst jä grad so op den Disch, as Jochen Kohrs vörn Landherrn.“
Bis in die neueste Zeit hinein redeten viele Bauern jedermann mit „du“ an. So ereignete sich im Jahre 1905 ein kleiner, drolliger Vorfall. In der Gastwirtschaft „Zur Harmonie“ war Ball. Mehrere Techniker, die damals beim Erweiterungsbau der Staatskrankenanstalt beschäftigt waren, darunter ein Herr Sye (sprich „Sie“), erschienen gleichfalls zum Fest. Man glaubte sich verpflichtet, sich dem anwesenden Gemeindevorsteher vorstellen zu müssen. Formvollendet beugte sich der erste vor dem schon etwas angeheiterten Burvogt: „Mein Name ist Sye.“ „O wat, o wat, ik segg du to di, du Flotz“, war die Antwort.
Auch übermütige Eulenspiegelstreiche waren an der Tagesordnung. Bei einer Wege- und Wasserschau hatte der Burvogt angespannt und die ganze Kommission auf dem Stuhlwagen in Langenhorn umhergefahren. Das schwere Werk war vollbracht. Die letzte Schau war in der Gastwirtschaft „Zum Wattkorn“ gewesen. Langsam zuckelte man in dem losen Sande der Tangstedter Landstraße dem Dorfe entgegen. Ein leckeres Abendessen winkte. Plötzlich lenkte der Burvogt rechts ab in den Dorfteich. „Aha, er will die Pferde tränken.“ Er fährt mitten in den Dorfteich hinein, das Wasser überspült bereits das Bodenbrett des Wagens. „Achtung, Füße hoch!“ Plötzlich schwingt sich der Burvogt auf das Sattelpferd, macht die Pferde los und reitet davon. Man lacht, man beklatscht den guten Witz und denkt, nun kommt er bald wieder mit den Pferden zurück und holt sie aus dem Teich heraus.
Aber „Prost Mahlzeit!“ Der Burvogt kam nicht wieder. Schließlich erhob die Kommission lautes Gebrüll, wodurch die Anwohner des Dorfteiches alarmiert wurden. Der Hufner Krohn ließ schließlich vorspannen und die Kommission aus dem Wasser ziehen.
Mal sitt Jan Pann bi Kraemer in‘n Krog. Do kümmt de Grönbur Gehrckens mit‘n groten Wagen vull Wittkohl. Kraemer köfft em jä wat af un leggt de Wittkohlköpp bi sik op de Toonbank. „Jä“, seggt Jan Pann, „Wittkohl mit Hammelfleesch is wat Goods, dat et ik so geern.“ „Denn nemm di man‘n poor Köpp mit“, seggt Gehrckens. „Ja, dat müch ik wull“, seggt Jan, „wenn ik mi een Kopp utsöken kann, de mi paßt, denn gev ik di ok‘n Reichsmark dorvör.“ „Dat kanns du hebben“, meent Gehrckens.
Jan Pann stiggt jä nu to Waag un fangt an to söken: „De is ne schön, de is to loos, denn mag ik ne, de gefallt mi ne, de paßt mi ne.“ So geiht dat ümmer wieder, un dorbi smit he eenen Kopp na de annern vun‘n Wagen hendal. Binah hett he denn halwen Wagen all ledig un de Kohlköpp trudelt op de Stroot. Dor kümmt Gehrckens anbössen: „Jan, Jan, wat maakst du dor?“ „Jä“, seggt Jan, „noch heff ik keenen funnen, de mi passen deit, aber ik will‘t Söken noch nich opgewen.“ Gehrckens müß man Hann‘n un Fööt tosamenleggen, dat Jan Pann plots dat Söken nalöt un vun‘n Wagen steeg.
Een annermal kumt Jan Pann mit sien beiden Mackers Hein und Fritz Beyer vu‘n Törfhannel ut Hamborg. Wenn de dree tohopen wären, hecken se allerlei Undrög ut. So ok dütmal. Bi denn Vogt Friedrich Wilhelm Gottfried Kraemer, de domals noch den Krog harr, kehr‘n se an. In de Krogstuw, gliek in de Eck bi de Dör, hatt de Kröger in so‘n groot Eckschapp Brot un Botter un Schinken. Dat wüßt Jan ganz genau. As de Kröger mal‘n Oogenblick ut de Dör kickt, is Jan gau bi dat Schapp un holt sik do‘n groote Mettwuß rut. Dormit wutscht he nu gau rut na‘n Wagen, wickelt de Wuß dor in‘n Stück Papier, stickt se ünner sin Jack un kümmt ganz harmlos wedder rin.
Sin Mackers wüssen je all Bescheid. Hein beföhlt em un gröhlt: „Minsch, wat hest du denn dor ünner din Jack? Dat is jo‘n Mettwuß, de möt wi gliek mal probieren.“ „Ja,“ seggt Fritz, „de kummt uns grod to Paß, ik heff‘n moordschen Hunger.“ „Och,“ seggt Jan so recht scheinheilig, „lat mi de Wuß doch ganz, de heff ik vör min Fro mitbröcht, denn schimpt se ne so dull, wenn ik so spät no Hus kum.“ „Nanu,“ seggt Friedrich Wilhelm Gottfried, „du büs doch süns ne so, Jan. Wenn du de Wuß ansnitts, gew ik Botter un Brot to.“ „Un wi gewt noch‘n Lütten ut“, röpen Fritz un Hein.
Jan kreg de Wuß her un sneed se an. Junge, dat wöör wat. „Dat harr ik ne dacht, dat‘n in Hamborg so‘n Mettwuß köpen kunn,“ säd de ool Kraemer, „de smeckt jä meist so good as Lisette ehr“ (dat wär nämli sin Fro). De beiden Beyers freten, dat jem dat Mul schüm. Jan löt sik ok ne lumpen, un de ool Friedrich Wilhelm löt sik ne geern vorbiarbeen, un so duur dat ne lang‘n do wär de Wuß all. De dree goht nu jä aff. An de Dör dreiht Jan sik üm, grient un seggt: „Ik bedank mi ok velmals vör de feine Beköstigung, Vogt.“ do güng‘n denn oolen Kraemer‘n Lüch op. „De verdreihte Oos, nu heff ik min eegen Wuß mit opfreten un heff noch Brot un Botter togeben!“
Eines Tages ist der Vorhöker und Landwirt Jochen Lau vom Buttereinkauf auf dem Lande heimgekehrt. Plötzlich erhebt sich auf seinem Hofe ein fürchterliches Gezeter. Die Nachbarin, meine Großtante eilt entsetzt hinüber und sieht zu ihrem Schrecken, wie der Bauer gerade seine Frau gottsjämmerlich verprügelt. „Naber, Naber, wat mokst du dor? Schomst du di denn gornich, dien Fro so to behanneln?“ „Ach wat,“, seggt Jochen, „dat mulsche Oos! Wenn ik to Hus kumm, denn schall min Fro sik frein as min Hund achter de Grootdöör.“ Derselbe Grobian aber sonst ein höchst gutmütiger Kerl.
Als sein Knecht und seine Magd sich miteinander verheirateten, rüstete er sie mit dem Notwendigsten aus und gab ihnen zur Hochzeitssuppe zwei fette Hühner. Zum Dank wurde er auch zur Hochzeit geladen. Das junge Paar aber war sehr sparsam, hatte die beiden Hühner nicht zur Hochzeitssuppe genommen, sondern sie für bares Geld verkauft. Die Hochzeitssuppe war infolgedessen sehr dünn.
Jochen Lau nimmt den ersten Teller: „Bannig flau“, denkt er. „Uns Herrgott wahnt an‘n Grunn“, seggt he und langt bei zweiten etwas tiefer in die Suppenschüssel. Genauso dünn wie vorher! Verwundert steht er auf, blickt in den Suppentopf, langt mit den großen Flossen hinein, rührt um und fragt zum Gaudium der übrigen Hochzeitsgäste ganz erstaunt: „Wo sünd denn de Höhner?“ Dieser Ausruf wurde zum geflügelten Wort in Langenhorn. Fiel irgendwo das Hochzeitsmahl zu kümmerlich aus, so hieß es gleich: „Wo sünd denn de Höhner?“
Früher erhielt Langenhorn fast alljährlich Einquartierung. Die 16. Husaren aus Schleswig ritten zum Manöver ins Munsterlager. In Langenhorn hatten sie in der Regel einen Ruhetag. Die Herren Offiziere fast immer bei dem „Herrenbauern“ Busse einquartiert, dessen Haushalt ganz vornehm städtisch aufgezogen war. Da gab es eine sauber mit Tischtüchern gedeckte Mittags- und Abendtafel, mit feinem Porzellangeschirr und Tafelsilber. Natürlich verursachte eine solche Einquartierung erhebliche Kosten, die keineswegs durch die gezahlten Vergütungen gedeckt wurden.
Busses Nachbar, der Vollhufner Hein Lau, erhielt ein paar Mann, meistens die Burschen der Offiziere, die sich dann gewöhnlich auch noch bei Busse durchfutterten. Busse hatte wiederholt gegen die ungerechte Verteilung der Einquartierungslasten Beschwerde erhoben, ohne Erfolg. Aber als seine Frau im Wochenbett lag, gelang es ihm, die Einquartierung auf seinen „Freund“ und Nachbarn Lau abzuschieben. Kaum sahen die Herren Offiziere die hochgetürmten, buntgewürfelten Bauernbetten, den Tisch ohne Tischtuch mit irdenem Geschirr und Holzlöffeln gedeckt, so machten sie kehrt und quartierten sich in der Gastwirtschaft ein.
Die Einquartierung erstreckte sich bis zum Alsterberg. Auch der alte Bauer und Gastwirt Jan Kiehn erhielt einen Unteroffizier, mehrere Mannschaften und Pferde. Jan Kien war sehr schwerhörig. Er saß am liebsten vor der großen Tür auf einer Bank im Sonnenschein und freute sich über seine prachtvolle Entenzucht. Seine drei stattlichen Töchter führten zur Hauptsache die Wirtschaft. Der Unteroffizier liebäugelte sofort mit den hübschen Mädchen, und als eine derselben gerade über den Hof ging, sagte er zu dem alten Jan Kiehn: „He hett ober‘n por hübsche Döchter!“ Jan Kiehn bewunderte gerade seine hübschen Enten und hatte nur das Wort „hübsch“ verstanden. Er nickte mit dem Kopf und antwortete: „Ja hübsch, sünd se wohl, ober se leggt man nich.“
Von dem Wundarzte, dem alten Mohrenweiser, berichtet die Überlieferung: Eines Morgens, schon sehr früh, kam ein Bauernbursche aus Garstedt angeritten, um seine ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Dem Burschen war der Unterkiefer ausgesetzt. Er hatte richtige Maulsperre mit starken Schmerzen. Er kam also in die Stube, sagte nicht guten Morgen, konnte vielmehr gar nichts sagen, stellte sich vor den alten Mohrenweiser hin, glotzte ihn an und grunzte irgend etwas. Der Alte fragte ihn, was ihm fehle. Wieder nur das Glotzen und Grunzen. Mohrenweiser dachte, der Bengel wolle ihn anulken, wie es häufig schon geschehen war. Mit den Worten: „Du verdreihter Bengel, wullt mi vör‘n Burn hebb’n“, schlug er ihm eine gehörige Backpfeife herunter. Schwapp, saß der Kiefer wieder im Gelenk, der Bursche war geheilt und Mohrenweiser hatte sechs Schillinge verdient.
Ein andermal hatte der Vollhufner Hein Friedrich Cordes schon mehrere Nächte furchtbar schlecht geschlafen. Der ganze Körper brannte vor Jucken. Er glaubte, eine Hautkrankheit zu haben und schickte zum Wundarzt. Inzwischen aber hatte sich herausgestellt, daß er nicht krank, sondern nur vollständig verlaust war. Nun ärgerten ihn aber schon die sechs Schillinge, die er dem Wundarzt für seinen vergeblichen Besuch zahlen sollte. Er stellte sich also auf den Hofplatz, von dem aus er den Arzt schon auf 400 Meter erblicken konnte. sobald der alte Mohrenweiser in Sicht kam, brüllte er ihm über das ganze Dorf mit Löwenstimme entgegen: „Herr Jese, Herr Jese, du brukst nich mehr to kamen, Herr Dokter, ick heff blots Lüs!“
Die Gabe des Hellsehens oder des zweiten Gesichts - in Niedersachsen gar nicht selten - war auch einem Bauernsohn, Hein Cordes, in Langenhorn gegeben, der unter dieser Erscheinung sehr stark litt. Da er bei meinen Eltern sehr häufig zu Besuch kam, haben wir oft darüber gesprochen. Seine Eltern hatten die Vollhufe II im Achterort, im „alten Dorfe“, in Besitz. Sein Vater war von 1857 – 60 Vogt in Langenhorn. Er und seine Kinder waren hochintelligente Leute. (Einer seiner Nachkommen ist heute Vermessungsrat in Hamburg). Schon in ganz jungen Jahren zeigte sich bei Hein Cordes das zweite Gesicht. Er erzählte: Eines Abends spät kommt er zu Fuß von Eppendorf; es ist eine pechschwarze Novembernacht. Die Langenhorner Chaussee war noch nicht lange ausgebaut. Er geht über die Brücke der Moorreye, kurz vor Udes Garten, und denkt, nun bin ich gleich zu Hause, denn der Fußweg durch die Wiesen hinter Fromheins Bauernhof muß gleich abbiegen. Richtig, er biegt ab, sieht vor sich ein Licht und denkt so bei sich: „das ist doch nicht Mutter, daß sie dir die Lampe vor’s Küchenfenster gestellt hat.“ (Das pflegte sie häufig zu tun, damit ihre Leute den Pfad über sumpfige Wiesen nicht verlieren sollten). Er geht und geht wie im Traum, ihm ist halt so seltsam, so wunderlich. Plötzlich hört er von Niendorf herüber den Glockenschlag der Kirche, wacht auf wie aus einem schweren Traum und steht unmittelbar vor der großen Moorkuhle am Tarpenbeck. Einen Schritt weiter – und er wäre verloren gewesen. Der Mond war inzwischen aufgegangen und zu seinem Entsetzen sah er vor seinen Füßen die Leichen einer Frau und zweier Kinder treiben. Eine Mutter hatte mit ihren beiden Kindern hier den Tod gesucht und gefunden.
Drei weitere Fälle ähnlicher Art sind mir von ihm erzählt worden. man könnte ja nun einfach die Sache als Aufschneiderei des Betreffenden abtun, aber folgender Fall beweist, daß tatsächlich irgend etwas daran sein muß. Unserer früherer Schullehrer Hans Joachim Hardkop erzählte uns Kindern eines Tages ganz erschüttert folgendes:
Hein Cordes und er standen an der Langenhorner Chaussee gegenüber dem Schäferhof und unterhielten sich. Hardkop verabschiedete sich und wollte den Fahrdamm überschreiten, als Hein Cordes ihn plötzlich am Rockärmel festhielt und ihm zurief: „Töw en Oogenblick, dor kümmt een Likentog!“ Entsetzt blickte Hardkop nach der völlig leeren Landstraße (er konnte nichts entdecken), und dann in die starren, gläsernen Augen des alten Cordes. „Nu is he vörbi, dat wör Hinr. Krohn.“ Tatsächlich starb der Betroffene am selben Tage noch durch einen Schlaganfall; und der von Cordes gesehene Leichenzug kam nach drei Tagen zur selben Stunde die Langenhorner Chaussee herunter.
Zum Schluß noch eine kleine Erzählung von ihm mit heiteren Ausgange. Vor 20 bis 30 Jahren lebte in Langenhorn eine Tagelöhnerfrau, die allgemein als sehr gutmütig und fleißig bekannt, leider aber dem Trunke stark ergeben war. Sie hatte einst bessere Tage gesehen. Sie wohnte Rodenkampweg 6 in dem Hause, das in Alt-Langenhorn ganz allgemein als „Grauer Esel“ bekannt ist. Eines Tages, in Katzenjammerstimmung, wollte „Tilli Tante“, so hieß sie überall, ihrem Leben ein Ende ein Ende machen. Hinter der Treppe beim Eingang in den „grauen Esel“ erhängte sie sich an einer Wäscheleine. Hein Cordes hatte am Mittag eine ganz unerklärliche Unruhe im Leibe. Obgleich das Mittagessen fertig auf den Tisch stand, seine Schwester Trina, bei der er wohnte, mit ihm schalt, er mußte los. Auf Holzpantoffeln schlorrte er durch’s Dorf zum „grauen Esel“ hinauf. „Wat wull ick eegentlich dor? Ick harr dor nix to söken ! Ick mok de Dör up, richtig, dor hangt „Tilli Tante“ achter de Trepp un spaddelt noch. Ick krieg mien Taschenmetz rut, fiedel ehr je aff un mok ehr de Sneer von Hals los. Ers jappt se noch’n por mol un do fohrt de dumme Oolsch up mi dol un schimpt mi ut, dat ick ehr de nee Wäschelien tweisneden heff. In mien Leben snied ick keen ool Wief wedder aff!“
Bis zum Jahre 1867 gehörte Langenhorn zum Zollgebiet Hamburg. Die Zollgrenze fiel mit der Landesgrenze zusammen. Zollkaten lagen am Ochsenzoll, Zollüberwachungsposten aber auch am Hummelsbütteler Kirchenweg, bei der Steinbrücke am Tarpenbeck und in Hummelsbüttel beim Gnadenberg. Von dort aus sollte die ganze Grenzlinie überwacht werden. Das war bei dem unübersichtlichen Gelände sehr schwierig, und infolgedessen blühte der Schmuggel.
Besonders die Anwohner der Nordgrenze am Grenz- und Bornweg, die zum Teil von der Grenze nur drei bis vier Meter entfernt wohnten, betrieben die Schmuggelei am eifrigsten und erfolgreichsten. Ja, es wird sogar behauptet, daß die kleinen Anbauern gerade im Schmuggel ihre Haupterwerbsquelle sahen. Geschmuggelt wurden alle Arten von Kolonialwaren: Kaffee, Zucker, Tabak, aber auch Salz und Eisenwaren.
Die Schmuggelware wurde der Sicherheit halber nicht im Hause der Schmuggler, sondern im Backofen untergebracht, der gewöhnlich etwas vom Hause entfernt lag. Damit sich möglichst niemand am Backofen zu schaffen machte, sprengten die Schmuggler das Gerücht aus, es ginge beim Backofen um, („dat spökt dor“). Die Gerüchte wurden dadurch bekräftigt, daß man zuweilen merkwürdige Erscheinungen dort gewahrte und Geräusche vernahm. Das waren natürlich die Schmuggler. Da sie die genaueste Geländekenntnis besaßen, glückte ihnen der Schmuggel sehr häufig.
In den regenschweren, pechschwarzen Nächten zogen sie, oft mit mehr als 100 Pfund Schmuggelware beladen, die geheimen Pfade durch‘s wilde Harts-, Ochsen- oder Tuckopsmoor der Grenze entgegen. Ließ sich‘s einmal ein Bauer, auf den sie nicht gut zu sprechen waren, gelüsten, auch einmal zu schmuggeln, so erhielten die Grenzer von ihnen einen Wink, und prompt wurde er dabei erwischt.
So geschah es, daß in Nordwest-Langenhorn, hinter Tomfort am Tarpenbeck eine ganze Wagenladung Schmuggelware abgefangen wurde. Schon tagelang lag die Ware unter einem großen Haufen Busch versteckt am Tarpenbeck zum Transport über die Grenze bereit. Die Garstedter Abnehmer waren benachrichtigt. In der verabredeten Nacht schien alles glänzend zu verlaufen. Es war eine stürmische, pechschwarze Nacht. Zur festgesetzten Zeit drüben ein Flüstern. Ein Feuerzeug glimmte auf. Alles war in Ordnung. Die gesamte Ware wurde in hastiger, schwerer Arbeit über den Tarpenbeck gereicht. Schließlich fragte man von der Garstedter Seite:
„Kummt noch mehr?“ „Ne,“ sagte der Langenhorner Schmuggler, „nun ist all!“ „Na, denn is man god“, war die Antwort. Windlichter flammten auf, Uniformen blitzten, drüben hatten zwei Zollwächter unverdrossen die ganze Ware in Empfang genommen.
Häufig aber schlug man den Zollwächtern ein Schnippchen. Wenn der Garstedter Schmied Eisen in Hamburg gekauft hatte, ließ er die Stangen etwa 100 Meter nördlich von der Gastwirtschaft Tomfort abladen. Er hatte eine ganze Reihe heranwachsender Jungens, die an dem Tage Kutscher und Pferd spielen mußten. Zuerst spielten sie bei den Zollwächtern an der Grenze. Mit vielem „Hü und Hott“ ging es hin und her und schließlich über die Grenze nach Langenhorn hinein. Hier banden sie vorn an jede Eisenstange ein starkes Band. Ein Junge wurde als Pferd davor gespannt, ein kleinerer führte Zügel und Peitsche, und dann ging es mit Hallo durch die Wiesen zum Tarpenbeck. Selbst auf kurze Entfernung hin konnte kein Zollwächter die Eisenstange, die in dem hohen Grase entlangschleifte, entdecken. Im Spiel wurde die ganze Eisenladung nach drüben geschafft.
Der Zimmermeister Samuel Hatje hatte einst einen größeren Posten Handwerksgeschirr in Hamburg gekauft, eine Ware, die sehr hoch verzollt werden mußte. Da er in Langenhorn einen Bau hatte, ließ er pro forma eine Partie Holz aufladen und zum Zollkaten fahren. Dort sollte er das Holz verzollen. „So veel Geld heff ik nich bi mi, denn lot dat Holt wedder trüg gan.“ „Kumt“, sagte er zu seinen Gesellen und Lehrjungens, „nehmt jo Geschirr, denn möt wi hüt op‘n Platz un in de Warkstell arbein.“ Schwupp, nahm jeder einen Posten des neuen Handwerksgeschirrs und ging unangefochten damit über die Grenze.
Dort, wo heute beim Bahnhof Ochsenzoll die Schlachterei der Produktion liegt, befand sich vor vielen Jahren eine Gastwirtschaft mit Namen „Zum hungrigen Wolf“. Hier verkehrten sehr viele Schmuggler, packten ihre Waren um und bereiteten sich für den Gang über die Zollgrenze vor. Eines Tages, es war mitten im strengen Winter, kehrte eine Garstedter Bauersfrau ein. Sie hatte in Hamburg einen größeren Posten Zeug gekauft. Im „Hungrigen Wolf“ wollte sie die Ware unter ihrer Kleidung unterbringen. Sie ließ sich in ein Zimmer führen, wo sie sich umkleiden konnte.
Das Zimmer war gut geheizt durch einen mächtigen Beileger- Ofen, dessen eiserne Platte neben anderen Verzierungen die Jahreszahl 1741 trug. Die Frau zog sich vor dem Ofen völlig aus und wollte das Schmuggelgut unmittelbar um den Leib legen. Sie bückte sich, um das Zeug aufzunehmen, berührte mit ihrer Sitzfläche die glühende Ofenplatte, und im Nu war ihr hinten die Jahreszahl 1741 mit Randverzierungen eingebrannt. Trotz der schmerzenden Brandwunde beendete die Frau ihren Schmuggelgang und brachte ihre Beute glücklich nach Hause.
Die Brandwunde aber entzündete sich. Sie war gezwungen, den Wundarzt, den alten Mohrenweiser, holen zu lassen. Der besah sich die verzierte Kehrseite der Frau, las die Jahreszahl 1741 und meinte kopfschüttelnd: „Ja, mien lebe Fro, dat is je alln ganz olen Schoden, wenn ick dorbi man noch veel moken kann.“
1867 wurde die Zollgrenze nach Eppendorf verlegt. Langenhorn war nun dem Zollgebiet des Norddeutschen Bundes angeschlossen. Viele Langenhorner versorgten sich vorher gründlich mit Kolonialwaren. Es wird behauptet, daß ganze Wagenladungen versteckt wurden, bevor die Zollgrenze verlegt wurde. Zwar wurden Nachsuchungen durch Zollbeamte angestellt, die aber fast immer ergebnislos verliefen. Die Zollgrenze in Eppendorf beim Mühlenteich bestand bis zum 15. Oktober 1888, und auch hier sind manche drollige Ereignisse beim Schmuggeln vorgekommen und viel belacht worden.
Johannes Nesselstrauch, ein Original, hatte sich ein neues Nachtgeschirr gekauft, das er verzollen sollte. Schwupp, kehrte er um, ließ sich im nahen Grünwarenladen für fünf Pfennig rote Beete und etwas Sand in das Gefäß tun, deklarierte nun auf der Accise seinen zu verzollenden Gegenstand als Nachttopf mit Inhalt, worauf er ohne Zoll davonkam.
Herrn Helmke, jedoch wurde seine außergewöhnliche Höflichkeit zum Verhängnis. Er wurde beim Schmuggeln erwischt, denn er hatte nicht daran gedacht, daß er in seinem hohen Spint (Zylinder), den er immer trug, eine Partie Kaffeebohnen untergebracht hatte. Als er durch den Zoll ging, sagten die Zollwächter: „Guten Tag, Herr Helmke“. Worauf er sehr höflich seinen Zylinder lüftete: „Guten Tag, guten Tag, meine Herren“ erwiderte er, wobei ihm die Kaffeebohnen über das Gesicht trudelten.